Appunti per un'Orestiade africana (Notizen zu einer afrikanischen Orestie)
Spielfilm, IT 1969, Farbe, 73 min., OmeU
Diagonale 2018
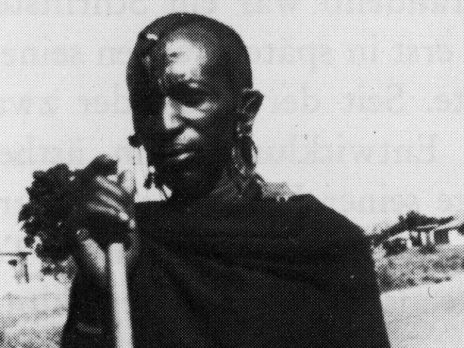
Regie, Buch: Pier Paolo Pasolini
Kamera: Giorgio Pelloni, Pier Paolo Pasolini
Musik: Gato Barbieri
Produktion: Idi Cinematografica Gian Vittorio Baldi
Die Diagonale’18 gedenkt
des Vermächtnisses der Filmwissenschaftlerin
Elisabeth Büttner
in der Reihe „Unvergessen“ mit
einem Screening und Buchpräsentationen.
Eine dokumentarische,
eine minoritäre, eine
experimentelle Perspektive auf
Appunti per un’Orestiade africana
(IT 1969) von Pasolini korrespondieren
mit drei posthum
erschienenen Büchern, an denen
Elisabeth Büttner (1961–2016)
teilhatte. Ihre Wege des Denkens
und Arbeitens, die Haltungen und
Vorschläge werden aufgegriffen,
weitergetragen und verändert.
Eine dokumentarische, eine minoritäre, eine
experimentelle Perspektive auf einen Film von
Pasolini korrespondieren mit drei posthum erschienenen
Büchern, an denen Elisabeth Büttner
(1961 – 2016) teil hat.
Appunti per un’Orestiade africana (1969) wird
von Pasolini mit einem kleinen Team vornehmlich
in Tansania und Uganda gedreht, weitere Teile an
der Universität in Rom sowie in einem Studio. Eingeschnitten
ist Wochenschaumaterial des Biafrakriegs.
Afrika ist am selben Wendepunkt seiner
Geschichte angelangt wie Argos zur Zeit Orests:
am Übergang von einer anarchischen Zivilisation
zur Demokratie.
Wesentliches Moment für Pasolinis Übertragung
des Mythos auf die afrikanische Realität
ist die von Aischylos thematisierte Ablösung
des anarchischen Matriarchats durch die Rationalität
des Patriarchats. Aus den Erinnyen, den
Furien der Rache, werden unter dem Schutz der
Athene,
der Göttin der Weisheit, die Eumeniden,
besänftigte
Göttinnen des Eingedenkens, mit dem
Schuld sühnbar ist. Diesen Vorgang der Ablösung
des Archaischen durch die Moderne, des Irrationalen
durch die Rationalität, des Stammeswesens
durch die Demokratie sieht Pasolini im Erwachen
Afrikas
zu seiner Entkolonisierung gespiegelt.
Zustimmend und ablehnend kommentieren afrikanische
Studenten an der römischen Universität
Pasolinis Vorhaben.
01
Das Dokumentarische impliziert als Modus
des Sichtbarmachens die Form der Überschreitung,
indem es bisher nicht sichtbare Verhältnisse
(Zusammenhänge) ausweist. Pasolini will – so
erklärt er zu Beginn – weder einen Dokumentarnoch
einen Spielfilm drehen, sondern die Möglichkeit
einer Versuchsanordnung ausloten. Leitmotivisch
dient dazu die Frage, ob die mythische Erzählung der Orestie, dieser antike Urstoff des
ersten menschlichen Gerichthaltens (als Folge des
Urkriegs um Troja), in das Afrika der 1960er-Jahre
versetzt werden kann.
Eine Schlüsselszene dieses Vorhabens ist
die Verwandlung der Erinnyen in Eumeniden,
also die zähmende Integration der archaischen
Rachegöttinnen in das neue System menschlicher
Rechtsprechung. Im Film findet Pasolini
dafür Bilder, die – aus seiner Sicht – von „einer
alten, magischen Welt“ zeugen. Die Darstellung
der Wiederholung
von Ritualen und Bräuchen an
einst heiligen Orten wird zur visuellen Demonstration
dieser Zähmung.
Allerdings handelt es sich hier um ein Projekt
im Konjunktiv. Der Film Appunti per un’Orestiade
africana ist somit ein Metafilm, der die geplanten
Schritte der ästhetischen Umsetzung bespricht –
doch nicht ohne zugleich die dazu notwendigen
Bilder der Dreharbeiten zur Verfügung zu stellen.
Szenen des Alltags und der Sitten in verschiedenen
afrikanischen Ländern 1969 werden auf diese
Weise festgehalten, die Aufnahmen sind Fragmente
historischer Wirklichkeit, die von der Fiktionalisierung
des auferlegten Mythos gleichsam in ihrer
Einsicht versetzt, gewendet werden.
02
Was tritt ans Licht, wenn die Kamera ihr eigenes
Scheitern aufzeichnet? Was kommt nach der
Frage: „Warum macht Pasolini weiter?“ Hinter
dem Scheitern das zwiespältige Fortbestehen von
dessen Gründen. Appunti, das kann auch „Vorhalt“
bedeuten.
Appuntare qn di qc: Pasolini filmt und macht
„Afrika“ – „non è una nazione, è un continente“,
wirft ein Student aus Äthiopien ein – nicht nur
zur Projektionsfläche seiner persönlichen Kapitalismuskritik
und der daran gekoppelten Interpretation
einer Orestie der Dekolonisierung. Er
verlangt zusätzlich, in Zukunft und auch in Europa
befreit zu werden durch eine proklamiert „afrikanische“
Synthese von „alt“ und „neu“, „traditionell“
und „modern“, „formale“ Blaupause
menschlicher „Demokratie“ und nationaler Gerechtigkeit. Die Ausbeutung des Kontinents mittels
alter, neuer, traditioneller, moderner kolonialer
Exotik findet hier kein Ende.
„Non vede la collusione“: Im Notieren der
Unmöglichkeit einer Synthese zwischen Zweitem
und Drittem Kino manifestiert sich ein fortgesetzter
Zusammenstoß der antagonistischen Standpunkte.
Was der Wissensüberschuss der Bilder
und der gefilmten Menschen dem Zweiten Kino
vorhält, operiert in fundamentalen Brüchen der
Kinosyntax. Die „materielle Präsenz“ der Tonbilder
integriert Kritik, die gegen die appunti
erhoben werden muss, aber schickt sich nicht an,
das Projekt zu rehabilitieren.
Die Stimmen der afrikanischen Studierenden
fordern die Dominanz des Voice-over heraus.
Die Jazzversion der Tragödie stürzt das gesamte
Dekor um – wie auch das Dritte Kino, die Revolution,
keine Alternative zu 1 und 2 ist. Sie fordern
radikales Erfinden, Ausdenken und komplette
Neuordnung nach totaler Unordnung.
Solidarität scheitert, solange die Kamera nicht
abgegeben, entwendet, gedreht, gegen sich selbst
gerichtet wird. Solange die Totalität von Pasolinis
Stimme und Blick nicht minoritär wird im eigenen
Denken, der „freien indirekten Rede“ Raum lässt,
die Orientierung im Takt verliert und den neuen
Rhythmen zuhört.
03
Notizen – einer probiert Bilder aus für ein
weiteres Vorhaben. „Die Bilder in Pasolinis Film
sind Entwürfe“, hält Harun Farocki fest „und der
Blick geht durch sie hindurch auf etwas anderes.“
Appunti als eine Reihe von Versuchen einer Übersetzungsarbeit
unbekannter Sprachen lesen – der
Orestie einerseits, Afrikas andererseits. Eine
Untersuchung, eine Suche nach einzelnen Wörtern,
ein Ausprobieren einzelner Ausdrücke im
direkten Bezug auf die Bilder und ihre Praktiken.
Skizzen – Zeigen und Verweigern. Präzision
anstreben und aufgeschlossen sein für das
Unvollkommene. Vorschläge für Zusammenhänge
machen; das Gezeigte provisorisch lassen, nicht
durch Kommentare ausgleichen. Gleichzeitig verschiedene statt chronologisch eine Wirklichkeit
zeigen. Dem Unfertigen und Beiläufigen
Raum und Bilder geben.
Möglichkeitssinn – auch als Ausdruck nicht
nachlassender Selbstkritik. „Kein Ding, kein Ich,
keine Form, kein Grundsatz sind sicher, alles ist
in einer unsichtbaren, aber niemals ruhenden
Wandlung begriffen, im Unfesten liegt mehr von
der Zukunft als im Festen, und die Gegenwart
ist nichts als eine Hypothese, über die man noch
nicht hinausgekommen ist“, schreibt Musil.
Brecht gebrauchen, ohne ihn zu kritisieren,
sei Verrat, warnt Heiner Müller. In diesem Sinn
werden wir Elisabeths Wege des Denkens und
Arbeitens, die Haltungen und Vorschläge weitertragen
und benutzen. Das heißt sie verändern.
Erster Ausdruck davon sind die drei posthum
erschienenen Bücher.
(Katalogtext, Christian Dewald, Viktoria Metschl, Vrääth Öhner,
Lena Stölzl)


