Das Schreiben und das Schweigen
Dokumentarfilm, AT/IT/DE 2009, Farbe+SW, 90 min., dOF
Diagonale 2019
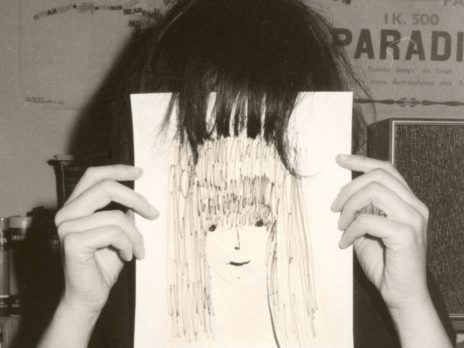
Regie: Carmen Tartarotti
Buch: Carmen Tartarotti, Georg Janett
Darsteller:innen: Friederike Mayröcker, Edith Schreiber, Peter Huemer, Bernhard Fetz, Hannes Schweiger, Julia Danielczyk, Aslan Gültekin, Isabel Centoglu
Kamera: Pio Corradi
Schnitt: Ferdinand Ludwig, Camen Tartarotti
Originalton: Carmen Tartarotti, Peter Utvary, Bruno Pisek, Martin Leitner
Produktion: Carmen Tartarotti Filmproduktion
Die Musikerin Anja Plaschg (Soap-
&Skin) zeigt Carmen Tartarottis
Das Schreiben und das Schweigen
und fügt dem heurigen historischen
Special eine poetische Note hinzu.
Der essayistische Dokumentarfilm
über die große Wiener Autorin und
Dichterin Friedericke Mayröcker
ist ein Kleinod im Programm und
hinterfragt die voreilig formulierte
Annahme, wonach sich Pamphlete,
Parolen und Politkunst besser
eignen, um über Weiblichkeitsbilder
nachzudenken, als Träumerei,
Poesie und Liebe.
„Ich will unbedingt Das Schreiben und das
Schweigen vorschlagen. Ich hatte ganz vergessen,
es ist die schönste Dokumentation über die geliebte
Friederike Mayröcker“, antwortete die Musikerin Anja
Plaschg (Soap&Skin) knapp, jedoch voller Inbrunst
auf die Frage, welchen österreichischen Film sie zum
heurigen historischen Special beisteuern wolle. Kein
Zufall, lassen sich doch zahlreiche Hinweise darauf
sammeln, dass es zwischen den künstlerischen Werken
von Mayröcker und Plaschg durchwegs Wahlverwandtschaften
gibt. Hier wie da hat das eine mit dem
anderen und alles mit allem zu tun; „unterirdische
Maulwurfsgänge“ nennt der Filmemacher und Autor
Alexander Kluge diese insgeheimen Verbindungslinien,
entlang derer ein Gedanke zum nächsten führt.
In Kluges Ausstellung „Pluriversum. Die poetische
Kraft der Theorie“ trafen die beiden Künstlerinnen
vergangenen Herbst auch aufeinander. Kluge hatte
beide eingeladen, an seiner Ausstellung mitzuwirken.
Seine Methode: die Montage. In diesem Fall von
künstlerischen OEuvres, die dabei in einen Dialog
treten. Ein Dialog, der bei Friederike Mayröcker und
Anja Plaschg stets ein Plädoyer für die Poesie ist.
„Mayröcker schreibt zu gut. Sprache ist ihr kein Mittel
identitärer Selbstdarstellung, Literatur kein Vehikel
zum Transport engagierter Postwurfsendungen.
Ihre Texte, auch wenn sie böse sind, schreien den
Leser nie an, ihr Witz ist von einer staubgewebhaften
Feinheit“, schrieb der Autor Magnus Klaue anlässlich
des Erscheinens von Mayröckers Erzählband
„Pathos und Schwalbe“ rund zehn Jahre nachdem
Carmen Tartarottis Film veröffentlicht wurde. Zurück
auf die Leinwand: Das Schreiben und das Schweigen
entstand 2008 in enger Zusammenarbeit mit
der großen Wiener Autorin und Dichterin. „Ich hab
gedacht, es soll ein Film über das Schweigen werden.
Das Schreiben und das Schweigen. Aber wie
macht man das dann? Vielleicht ist es bei anderen
Autoren so, dass sie beim Sprechen andere Sachen
hervorholen aus ihrem Hirn, während ich nichts
hervorholen kann. Ich mag nicht sprechen! Und auf
dieser Grundlage werden wir unseren Film aufbauen.
Das machen wir!“, sagte Friederike Mayröcker
damals über den Film. Tartarotti hatte bereits 1989
einen Film über die Autorin gemacht; nach dem Tod
von Mayröckers Lebensmenschen Ernst Jandl im
Jahr 2000 beschlossen die beiden Künstlerinnen,
einen weiteren Film zu gestalten. Das Schreiben und
das Schweigen ist kein biografischer Film, vielmehr
der Versuch einer filmischen Annäherung an die
unverkennbare und einzigartige Poesie und Sprache
Friederike Mayröckers. Innerhalb des historischen
Specials mag der Film vordergründig wie ein Fremdkörper
wirken, das Gegenteil ist der Fall. Er ist ein
Kleinod und ein flammendes Plädoyer für die Poesie,
nicht zuletzt hinterfragt er die voreilig formulierte
Annahme, wonach sich Pamphlete, Parolen und
Politkunst besser eignen, um über Weiblichkeitsentwürfe
nachzudenken, als Träumerei, Poesie und
Liebe. Man kann von einem unendlichen Glücksfall
sprechen, dass Das Schreiben und das Schweigen
gerade jetzt erneut auf der Diagonale zu sehen ist
und gerade jetzt einen Beitrag zu diesem historischen
Special formuliert.
(Peter Schernhuber)


